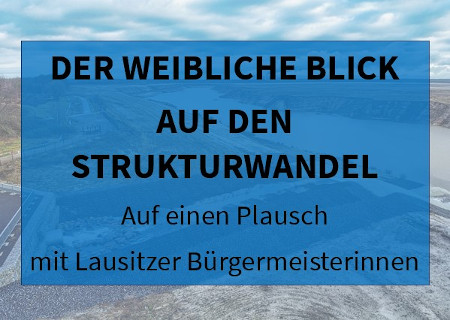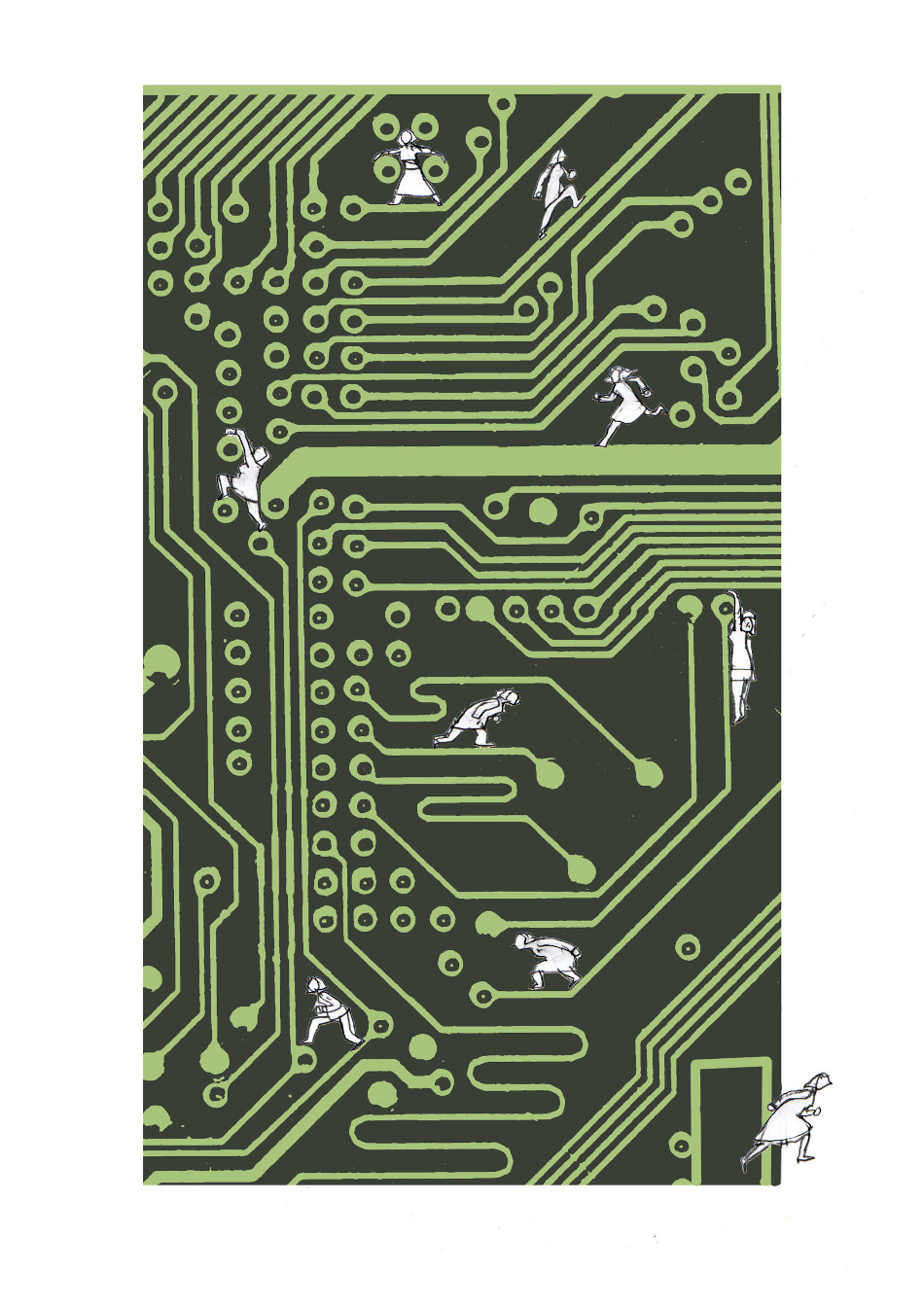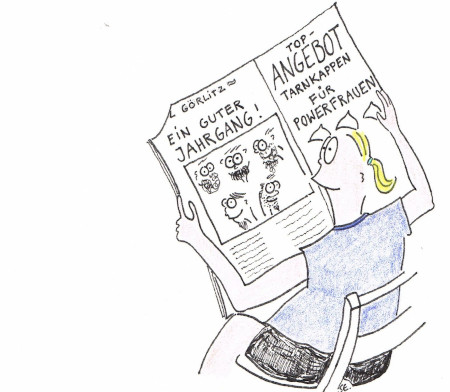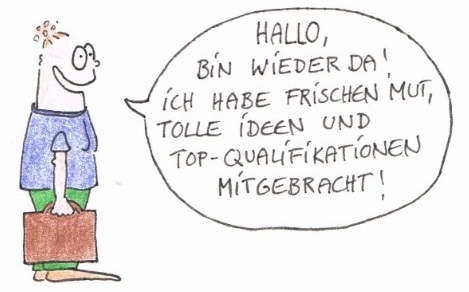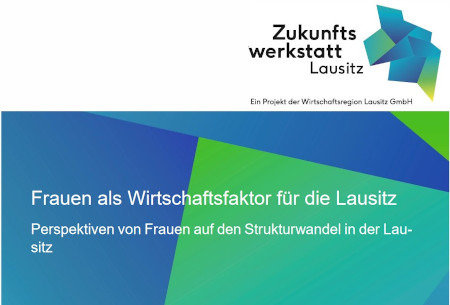Ob Braunkohleabbau oder Strukturwandelkommissionen: Auf den ersten Blick scheinen diese Bereiche Männerdomänen zu sein. Dabei gibt es genügend weibliche Perspektiven auf die Lausitz. Besonders in Brandenburg fällt eine Vielzahl Frauen auf, die sich gemeinsam der Herausforderung angenommen hat, den Strukturwandel mitzugestalten. Sie setzen sich in der Lausitzrunde als Regionalpolitikerinnen für ihre Region ein. Und das ist gut so, denn unter den 58 Mitgliedern sind nur 10 Frauen. Unsere Autorin Ann-Kathrin Canjé hat mit vier von ihnen gesprochen.
Mit Christine Herntier, Simone Taubenek, Elvira Hölzner und Birgit Zuchold komme ich zu Corona-Zeiten kurzerhand für meine Interviews am Telefon zusammen. Welche persönlichen Herausforderungen der Strukturwandel für sie und ihre Regionen hat, wie sie ihre Rolle und die von Frauen dabei einschätzen und wie sie die Veränderung gestalten wollen – darüber habe ich mit ihnen gesprochen. Was alle gemein haben: sie sind entschlossen, unerschrocken und zukunftsorientiert.
Auf einen Plausch mit vier Lausitzerinnen.
………………………………………………………………………………………………………………………….
Infos zur Lausitzrunde
Aktuell umfasst die Lausitzrunde 58 Mitglieder. Sie ist ein länderübergreifendes und freiwilliges Bündnis, das aus der Initiative einzelner Kommunen entstand und die Lausitz in ihrer Gesamtheit repräsentiert. Die Stadt Spremberg hat das Mandat für die Kommunen übernommen. Bürgermeisterin Christine Herntier vertritt als Sprecherin die 58 teilnehmenden Kommunen.
Als Ziel hat sich die Lausitzrunde laut Christine Herntier gesetzt, die negativen Folgen der vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen zu formulieren, Strategien für einen möglichen Umgang damit zu entwickeln und Zukunftskonzepte für die Lausitz zu schaffen, die dann gemeinsam vertreten und umgesetzt werden. Ein Cluster mit einzelnen erarbeiteten Aspekten gibt es hier.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
AUF EINEN PLAUSCH MIT…
…Christine Herntier, Bürgermeisterin Spremberg
Ein Tagebau vor der Haustür, ein Kraftwerk im Industriepark Schwarze Pumpe – Christine Herntier hat konkrete Bilder vor Augen, wenn sie über die Herausforderungen des Strukturwandels redet. Als Mitglied der ehemaligen Kohlekommission und Sprecherin der Lausitzrunde beschäftigt sie sich ausgiebig mit dem Kohleausstieg und seinen Folgen. Durch ihre Arbeit in der Kohlekommission habe sie zunächst einmal lernen müssen, dass die Lausitz von den verschiedenen Kohlerevieren die schlechtesten Voraussetzungen habe, weil nur wenige Unternehmen ihren Sitz in der Lausitz hätten. Es sei schwer, sie von einer Investition etwa in Form von zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen zu überzeugen. Das Wort „zukunftsträchtig“ ist Christine Herntier wichtig, da sie früher immer von „Industriearbeitsplätzen“ gesprochen hätte. Nach tiefgehender Beschäftigung mit dem Thema änderte sie ihren Sprachgebrauch.
Die Sprembergerin sieht eine wichtige Aufgabe darin, eine neue Wissenslandschaft in der Lausitz aufzubauen. Dabei sollte man nach vorne schauen: „Wie kann es uns gelingen, der Lausitz ein Image und uns selbst ein Gefühl zu geben, dass es richtig und wichtig ist, dass es nicht mehr so sehr darauf ankommt, mit der Schippe die Kohle aus dem Schacht zu fördern, sondern neue Wirtschaftszweige, neue Wissensarbeitsplätze zu etablieren?“
Nach 30 Jahren Strukturbruch, so viel stehe für sie fest, müsse man den Menschen eine Perspektive bieten, vor allem, weil das Vertrauen an das Gelingen des Strukturwandels heute vielen fehlen würde.

Christine Herntier selbst hat ihr Berufsleben vor allem in der Textilindustrie verbracht und live miterlebt, was Strukturbruch und Strukturwandel bedeuten. „Im Unterschied zu denjenigen, die darüber entscheiden, sei es über ihr Mandat als Abgeordnete oder dass sie in der Regierung sind, weiß ich wirklich, wovon ich da rede. Ich habe in der Textilindustrie mitgemacht, was es bedeutet, wenn jemand entscheidet ‚Das kann dann mal weg‘, ohne, dass man einen Plan hat, was danach kommt.“
Und vor diesem „was danach kommt“ scheinen viele Menschen in der Region Angst zu haben. So sei laut Herntier auch der demographische Wandel eine Herausforderung. Sie betont, dass vor allem junge Frauen die Lausitz verlassen hätten. Wie kann man ihnen wieder Lust auf die Lausitz machen, wo sie doch so wichtig für die Region sind?
Eine Chance sieht sie etwa im Zugang zu gut bezahlten alten und neuen Arbeitsplätzen für Frauen. Die Lausitz sei „besonders für Frauen ein Raum, wo man sich verwirklichen kann. Wie ich finde auch anders als in Großstädten, wo man viel gedrängter ist. Es gibt hier besonders für Familien hervorragende Bedingungen.“ In ihrem Bekanntenkreis versuche sie zudem, Frauen für die Kommunalpolitik zu begeistern. Dort sehe sie noch echten Spielraum, Politik mitzugestalten.
Damit mehr Menschen auf die Chancen in der Lausitz aufmerksam werden, setzt sich Christine Herntier auch privat ein. Im Jahr 2017 hat sie eine Initiative für Rückkehrer*innen initiiert, Heeme fehlste . Wie kam es dazu? „Im Freundes- und Bekanntenkreis treibt die Menschen sehr um, dass die Kinder weg sind. Mich hat das auch sehr betroffen. Ich habe jetzt auch zwei Enkelkinder und bin sehr glücklich darüber, dass meine Tochter mit Familie nun wieder in Spremberg lebt und mein Sohn auch in der Nähe. Die waren davor in der halben Welt verstreut. Deshalb habe ich mich sehr für eine Rückkehrerinitiative in Spremberg eingesetzt.“
Somit ist für sie selbstverständlich, dass sie ihre eigenen Ideen miteinbringt. Dass sie sich so für die Rückkehrer*innen einsetzt, hat auch einen Grund: „Das tut uns so Not in der Lausitz, dass hier Leute kommen, die auch mal weg waren, die da auch gewissen Zweifeln Paroli bieten können. Ich möchte gerne, dass wir modern, aufgeschlossen und innovativ sind.“
Christine Herntier ist sich sicher: in der Lausitz geht etwas in den nächsten Jahren. Für sie sei es immens wichtig, den Leuten zu zeigen, wie frei sie sich hier entwickeln könnten. Dafür sei es auch so wichtig, dass politische Entscheidungsträger Ideen zuließen und nicht jeden innovativen Gedanken gleich ausbremsen würden. „Und es ist nicht damit getan, 40 Milliarden irgendwo hinzuhängen. Die müssen auch sinnvoll ausgegeben werden können“, mahnt Herntier.
…Simone Taubenek, Bürgermeisterin Forst (Lausitz)
Im Mai 2018 hat Simone Taubenek ihr Amt als Bürgermeisterin der Stadt Forst übernommen und ist in die Lausitzrunde eingetreten, um gemeinsam mit anderen Lausitzer Städten den Strukturwandel zu gestalten. Auch Forst ist zum Teil vom Ausstieg aus der Braunkohleverstromung betroffen. Der Ort Horno etwa musste schon vor Jahren dem Braunkohleabbau weichen und ist heute ein Forster Stadtteil. Mit dem Klappern der Bagger sei es aber auch heute nicht vorbei: „Der Strukturwandel betrifft die Menschen natürlich auch in dieser Stadt insofern, als dass viele im Braunkohletagebau oder auch in Zulieferbetrieben arbeiten. Da ist die Frage der Zukunftsfähigkeit dieser Stadt natürlich auch eine Frage von Existenzen der Arbeitsplätze.“
Denn früher war Forst laut Taubenek so etwas wie „das Manchester des Ostens“ und gehörte in Hochzeiten der Textilindustrie zu den reichsten Städten in Deutschland. Als diese Industrie so wie einige andere Bereiche komplett weggebrochen sei, führte das bei vielen Menschen zur Langzeitarbeitslosigkeit. Damit stelle sich heute die Frage, welche Kompensationsmaßnahmen es für das Wegbrechen eines weiteren Industriezweigs geben könne. Besonders jungen Menschen soll in Forst eine Perspektive, etwa auf Ausbildungsplätze, geboten werden. Wie diese gestaltet werden könnten – solche Fragen treiben die Forster Bürgermeisterin um.
Froh ist sie, dass besonders Frauen, die in der Wirtschaftsregion Lausitz engagiert seien, den Strukturwandel etwa durch Projekte wie der Kreativen Lausitz schon jetzt besonders prägen würden. Auch das Engagement ihrer Kollegin Christine Herntier lobt die Forster Bürgermeisterin sehr, da sie die Interessen der Lausitz in der Kohlekommission vertreten habe und aktuell daran arbeite, den aus ihrer Sicht „mit einer heißen Nadel gestrickten Kompromiss auch in Gesetztesform umzugießen.“

Für den Entwicklungsprozess seien auch die unzähligen Vereine und aktivistischen Frauen wichtig, die sich immer vehement für die Mitgestaltung ihrer Lebensverhältnisse einsetzen würden. Und so sei es auch für Simone Taubenek eine Herausforderung, die Möglichkeiten zur Veränderung im Ort zu erkennen und voranzutreiben.
Aktuell nehme sie in ihrer privaten Umgebung sowie der Bevölkerung durch die Corona-Krise Sorgen wahr, da unklar sei, welche Auswirkungen diese auch auf die finanziellen Mittel für die Regionen haben könnte: „Das vermischt sich jetzt natürlich alles mit der Angst, was denn jetzt passiert, wenn so hohe Kosten in der Pandemie und auch als Pandemiefolge entstehen. Ist dann tatsächlich noch dieser große Batzen von 40 Milliarden Euro für die vom Kohleausstieg betroffenen Reviere für die Strukturänderung vorhanden?“ Eine Frage, die auch andere Gemeinden umtreibt, aber die noch nicht in Gänze beantwortet werden kann. Doch Simone Taubenek hat auch die möglichen positiven Folgen von Corona schon im Hinterkopf, beispielsweise den Anspruch auf Home-Office. Dieser könnte sich positiv auf die Region Forst auswirken, weil es mit einer Home-Office-Regelung keine Rolle mehr spielen würde, wo die Menschen wohnen: „Dann brauche ich attraktive Grundstücke und billiges Wohnen – das sind alles Sachen, die bei uns gegeben sind. Wir haben hier im Vergleich zu anderen Städten, weil hier mal Glasfasernetz verlegt worden ist, sehr gute Voraussetzungen. Wir sind direkt an der Autobahn, direkt an der polnischen Grenze. Wir wohnen im Grünen, hier ist es ruhig. Das muss man versuchen, in einem Marketingprozess zu vermitteln.“
Zukünftig bleibt es für Simone Taubenek eine große Aufgabe, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen und die Entwicklungen des Strukturwandels an die Bevölkerung zu kommunizieren.
…Elvira Hölzner, Amtsdirektorin Peitz
Eine gute halbe Stunde von Forst entfernt liegt das kleine Städtchen Peitz. Hier setzt sich Elvira Hölzner seit 2007 als Amtsdirektorin für ihre Stadt ein und hat ähnliche Erfahrungen wie ihre Kolleginnen aus der Lausitzrunde gemacht. Das Gespräch mit den Bürger*innen, die Vermittlung von politischen Entscheidungen im Hinblick auf den Strukturwandel – das sind Aufgaben, die sie bewegen.
Sie merke, dass noch viel Unkenntnis bei den Leuten herrsche, welche Kraftwerke nun eigentlich vom Netz gingen. Es wäre wichtig von ihren Bürger*innen zu erfahren, wie sie sich den Strukturwandel vorstellten. Das könnten einfache Wünsche sein oder direkte Projektvorschläge – bisher seien schon viele gute Ideen durch die Bevölkerung an sie herangetragen wurden.
Von der Lausitzrunde erhofft sie sich vor allem Unterstützung, ein Gemeinschaftsgefühl: „Für uns war es ganz wichtig, im Strukturwandel nicht alleine dazustehen. Wir sind ein Amt mit circa 10.000 Einwohnern und wir haben uns Partner gesucht, mit denen wir im Strukturwandel zusammenarbeiten können. Das ist ja nicht nur ein Problem des Amtes Peitz, sondern der gesamten Region.“
Im Jahr 2023 läuft in Peitz der Tagebau Jänschwalde, der auch die Stadt Forst betrifft, aus. Das dortige Kraftwerk ist eines der ersten, das im Jahr 2028 vom Netz gehen soll. Somit ist klar, dass sich die Stadt ähnlich wie ihre Nachbarstädte auf neue Industriearbeitsplätze in der Region fokussieren möchte. Das sei ganz besonders wichtig, weil sie den Menschen, die jetzt im Kraftwerk oder Tagebau arbeiten würden, schnell eine Perspektive bieten müsse, damit diese jetzt schon wüssten, wo sie zukünftig arbeiten könnten. Aber nicht nur das: „Wir wollen natürlich keine Industriearbeitsplätze bauen, die nur für Männer sind. Das hat sich schon längst gewandelt und sollte natürlich auch für Frauen sein und für Männer.“

Gleichberechtigte Arbeitsumfelder also. Frauen in Führungspositionen gebe es schon viele in der Region, sei es in der Planung des Tagebaus oder Flutung des Cottbusser Ost-Sees – dahinter standen Frauen. Generell würden sie laut Elvira Hölzner ohnehin immer mehr in technischen Berufen einsteigen. Zukunftsorientiert soll es aber nicht nur in der Rollenverteilung beim Berufsbild gehen: „Bei den Industriearbeitsplätzen denken wir da vor allem in Richtung klimaneutral. Beispielsweise Busse oder LKWS auf E-Mobilität umrüsten. Das wird ja auch die Zukunft sein.“
Und auch bei anderen Bereichen wie etwa der Fischerei müsse man schauen, wo eine sinnvolle Entwicklung nötig ist, denn auch hier wären Arbeitsplätze durch die Abschaltung des Kraftwerkes möglicherweise gefährdet.
Für Elvira Hölzner steht jedenfalls fest, dass die Regionen den Strukturwandel nicht alleine bewältigen würden, sondern dass es auf die Unterstützung von Land, Bund und EU ankomme. Dazu müsse aber auch klar formuliert werden, was die Lausitz brauche. „Um so eine Region gesund zu entwickeln, braucht man zwei Beine, die fest stehen. Das eine sind die Industriearbeitsplätze. Und auf der anderen Seite der Tourismus. Der hat sich in unserem Amt vor allem in den letzten Jahren gut weiterentwickelt.“
Und letztlich sei es auch der Zusammenhalt der Peitzer*innen, der die Stadt stärke. Der in Peitz ansässige Werg e.V., den eine Frau leitet, kümmert sich etwa um die Wiedereingliederung von Randgruppen, führt und leitet die Tafel und kümmert sich um die Integration und Betreuung von Geflüchteten. Weil sie kein Sozialamt mehr habe, sei das in der Stadt nötig. Strukturwandel heißt also vor allem auch: die Notwendigkeit von Zusammenhalt und Perspektiven für alle erkennen und fördern.
…Birgit Zuchold, Bürgermeisterin Welzow
Die Probleme, mit denen sich verschiedene Orte der Lausitz im Strukturwandel auseinandersetzen müssen, sind vielfältig, aber ähneln sich doch in gewisser Weise. Die Stadt Welzow, deren Bürgermeistern Birgit Zuchold ist, gehört zu einer der betroffensten Städte im Lausitzer Revier. Aktuell laufen Verfüllungsarbeiten in einem Abschnitt des dortigen Braunkohletagbaus, der nur 500 Meter von der Stadt entfernt ist. Täglich hören die Menschen die Bänder, Durchsagen, Geräusche der Absetzer.
Schon früh habe Welzow rund 1000 Einwohner*innen durch die Inanspruchnahme von Fläche für die Braunkohleabbaggerung an die Braunkohlebagger verloren. Sie sind weggezogen, haben sich an einem anderen Ort niedergelassen. Heute besitzt Welzow keinerlei Entwicklungsflächen mehr. Das seien alles Gründe, die die Stadt in eine außerordentliche Situation gebracht haben, deshalb war es für Birgit Zuchold ungemein wichtig, mit Sprembergs Bürgermeisterin Christine Herntier zusammenzuarbeiten. Als diese damals aufeinander zukamen, sagten sie sich: „Wenn wir nichts tun, dann können wir den Menschen hier keine Perspektiven bieten. Und wenn wir jetzt nicht die gesamte Lausitz wachrütteln – länderübergreifend – dann sind wir kein politisches Schwergewicht. Denn: Wen interessieren im bundespolitischen Maßstab überhaupt eine Million Einwohner? Keinen Menschen. Und auch keine Bundestagsabgeordneten. Dann haben wir gesagt: Wir müssen laut werden.“

Auch die Zusammenarbeit mit den sächsischen Kommunen sei dabei sehr wichtig gewesen. In der Lausitzrunde setzen die Frauen sich für ihre Regionen ein. Das sei vor allem so wichtig, da die Menschen in den betroffenen Regionen auf die politische Ebene schauen und sich erhoffen, dass sie den Weg bereite. Viele seien mittlerweile wie hypnotisiert: „Wenn Sie zurückschauen in die Geschichte, dann haben wir zu DDR-Zeiten nicht unbedingt Eigenständigkeit vermittelt bekommen. Und viele Menschen haben es hier auch nicht gelernt aufzustehen und ihren eigenen Weg zu gehen. Dass der Staat vieles für uns organisiert hat, das hallt in vielen Bereichen ja immer noch nach.“
Somit sei es für die in Welzow geborene und aufgewachsene Bürgermeisterin auch eine Herausforderung, die Menschen zu begeistern, ihnen zu zeigen, dass sie Teil des Strukturwandels seien, besonders bei den jungen Menschen. Weil ihre Zukunft in der Lausitz oft unklar sei, stünde schnell die Option für einen Umzug aufgrund eines neuen Arbeitsplatzes zur Diskussion. Deswegen sei es auch so wichtig, Perspektiven durch nachhaltige Arbeitsplätze zu bieten.
Auf die Frage, wie man Frauen in der Lausitz stärker einbringen könnte, setzt ihre Antwort ganz früh an – in der Schule. Denn in ihren Augen könne man nur schwer beeinflussen, welchen Beruf Frauen ergreifen. Daher sei es wichtig, schon bei Kindern damit anzufangen: „Man muss frühzeitig beginnen, um den Kindern die Vielfältigkeit der Berufe nahe zu bringen.“ Dazu zähle für sie, möglichst gleichberechtige Berufsbilder zu zeigen und auch durch entsprechende Schulfächer Kindern gleichermaßen handwerkliche Fähigkeiten beizubringen.
Für die Lausitz und die Stadt Welzow sieht Birgit Zuchold das Potential in der Landwirtschaft, der Bioökonomie und in Unternehmen, die alternative Medizin herstellen wollen. Sie setze auf günstige Leerstandsgebäude, die für Unternehmen attraktiv wären und will sich für diese und andere Themen in den kommenden Jahren in ihrer Stadt einsetzen: „Ich sehe im Wertstoffhandel und in der Aufbereitung von diesem Potential, weil alles, was wir wegwerfen, zu neuen Produkten überarbeitet werden muss, die wiederverwendungsfähig sind. Da sind wir noch am Anfang. Wobei ich mir im Klaren bin, dass alles, was recycelt wird mit einem hohen energetischen Aufwand verbunden ist. Insofern braucht das auch neue Verfahren, die Wissenschaft und Forschung anregen, damit man nicht wieder neuen Müll produziert.“
Was es vor allem brauche, das macht sie klar, sei Planungsbeschleunigung und „eine Bundesregierung, die uns unterstützt und das versprochene Wort hält. Wir brauchen doch Verbindlichkeit in diesem Strukturentwicklungsprozess.“
……………………………………………………………………………………………………….
Die Aufgaben, die der Strukturwandel mit sich bringt, sind vielseitig. Je nach Region variieren die Herausforderungen sicherlich, aber bei den meisten meiner vier Gesprächspartner*innen gab es doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Themen wie Nachhaltigkeit, besonders im Hinblick auf neue Arbeitsplätze, politische Teilhabe oder gesellschaftlicher Zusammenhalt stehen für sie im Fokus wenn sie in die strukturwandelgeprägte Zukunft blicken. Innovativ bleiben und auf Vernetzung setzen – diese zwei Aspekte werden die Bürgermeister*innen sicher weiterhin in der Lausitzrunde einbringen.
Ann-Kathrin Canjé…
… ist schreib-,musik- und leseaffin. Ihr liegen die kleinen, unauffälligen Geschichten des Alltags am Herzen, die sie meist in Kurzgeschichten festhält. Wenn sie nicht kreativ schreibt, ist sie als Volontärin beim MDR tätig.