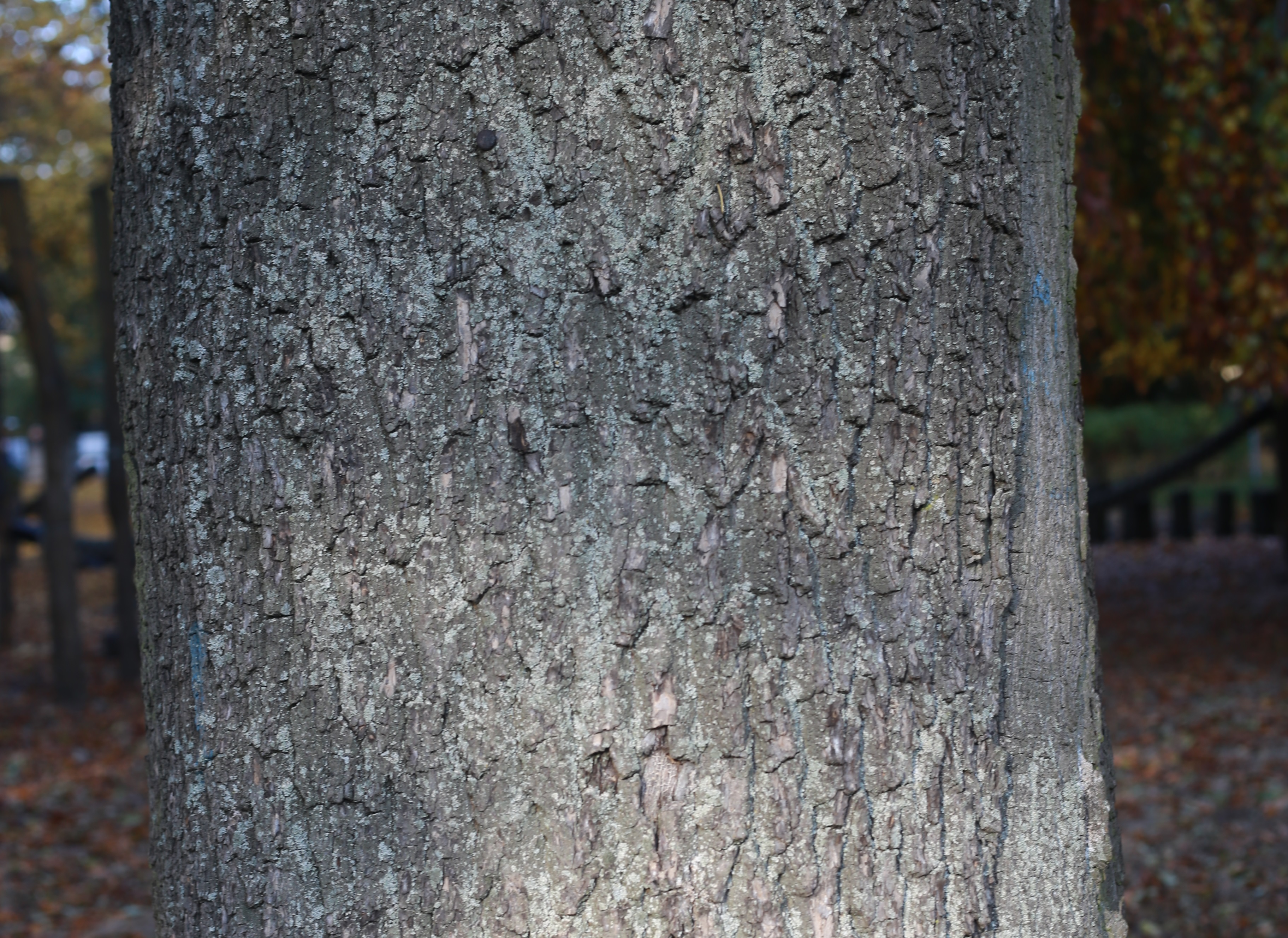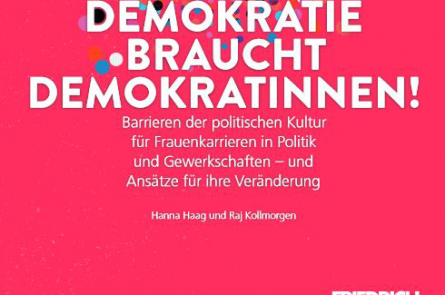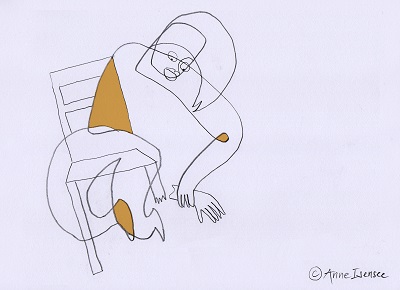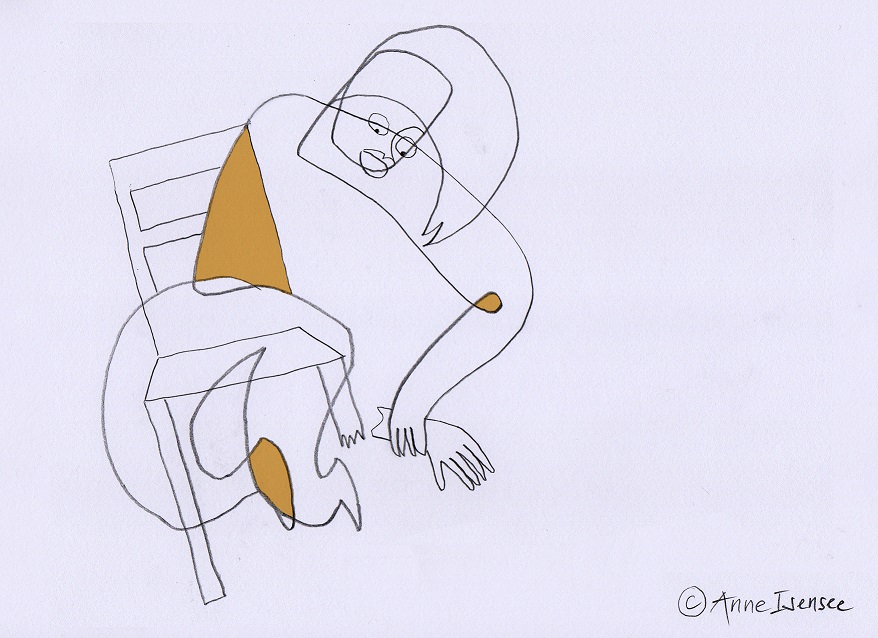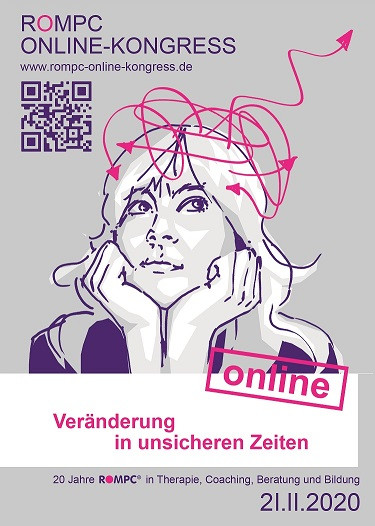“Wir müssen einfach aus einer schwierigen Situation das Beste machen”

Schon bei unserem ersten Telefonat mit Frau Meier (Name von der Redaktion geändert) ist ihr Multitasking Talent zu spüren. Sie ist gerade auf Arbeit, ansteckend gut gelaunt und beantwortet zwischen zwei Sätzen die Frage einer Kollegin, gibt das Diensttelefon weiter, grüßt Bewohner. Stressige Situationen scheint sie geübt mit einer eleganten Mischung aus echter Freundlichkeit und Pragmatismus zu meistern. Später wird sie selbst dazu sagen: „Unser ganzes Leben besteht aus Management; mein ganzer Tagesrhythmus ist getaktet“. Frau Meier arbeitet als Altenpflegerin in einem Pflegeheim in der Lausitz und ist Mutter von zwei Kindern. Auch ihr Mann arbeitet im Pflegebereich, beide im Schichtdienst. Was das konkret bedeutet, davon erhalten wir im Gespräch mit ihr einen Eindruck und, um es vorwegzunehmen: die Realität erschlägt uns förmlich. Dass Schichtdienste und noch dazu die Vereinbarkeit mit Familienleben keine Leichtigkeit sind, war uns – so dachten wir – bewusst. Doch was das im Detail mit sich bringt, wird uns erst durch Frau Meiers eindrucksvolle Schilderungen klar.
Frau Meier ist vor vielen Jahren aus Überzeugung Altenpflegerin geworden, liebt ihren Beruf und übt ihn mit Leidenschaft aus. Doch auf die Frage, ob sie sich heute wieder für diesen Weg entscheiden würde, kommt sie ins Stocken:
„Wenn ich mit meinem Herzen entscheiden würde, würd ich sagen, ich liebe meinen Beruf über alles und möchte an sich nichts anderes machen. Aber mein Verstand sagt mir, in der heutigen Zeit hätte ich es vielleicht nicht mehr gemacht. Denn man hat so viele Entbehrungen, die man in Kauf nimmt. […] Leute, die im Büro arbeiten, von Montag bis Freitag, verdienen mehr als ich. Und wir gehen ja in Schichten, Wochenende, Feiertag, jeden Tag sind wir mit todkranken, alten Leuten zusammen, wir sehen viel Leid, wir sehen viel Elend“.
Im Pflegeheim arbeiten mehrere Berufsgruppen zusammen, und jede einzelne ist wichtig. Während Pflegehelfer*innen allein für die Körperpflege und den Kontakt zu den Bewohner*innen zuständig sind, was neben dem Waschen unter anderem auch Begleitung zu Toilettengängen, das Essen reichen, Lagern der Bewohner*innen und andere Tätigkeiten beinhaltet, übernehmen Pflegefachkräfte wie Frau Meier auch Aufgaben der medizinischen Versorgung wie Medikamentengabe, Kontakt mit den Hausärzten, Wundversorgung.
„Wir haben eine sehr hohe medizinische Ausbildung! Subkutan spritzen, Katheter legen, Tracheostoma versorgen … wir sind eigentlich wie eine Krankenschwester, nur im Heim. Aber wir haben drei Jahre gelernt und dürfen nichts alleine machen. Ich brauche für [alles] eine Anweisung“.
Bedeutet praktisch: hat ein*e Bewohner*in beispielsweise Fieber, so muss ein Arzt eingeschaltet werden. Da es, im Gegensatz zum Krankenhaus, keinen Arzt auf Station gebe, muss sie zwangsläufig den Bereitschaftsarzt rufen. Frau Meier wünscht sich für ihre Berufsgruppe mehr Entscheidungsfreiheit, da dies auch die Bereitschaftsärzte entlasten und dadurch fachlichen Reibereien vorbeugen würde, welche nicht selten auftreten.
“Es ist anstrengend, immer lieb zu sein”
Zwischenmenschliche Konflikte scheinen generell ein Teil des Alltags im Pflegeberuf zu sein, der uns vorher in dem Maße nicht bewusst war. So berichtet Frau Meier über die Kommunikation mit Bewohner*innen und deren Angehörigen:
„Ein Großteil der Bewohner ist sehr dankbar und das ist eben auch schön so in unserer Arbeit. Manche denken, sie kriegen zu wenig Aufmerksamkeit und die Schwestern müssten mehr Zeit haben. Das ist eben schwierig zu vermitteln! Wir versuchen dann schon zu erklären, wenn wir halt - auf gut Deutsch gesagt - nur zwei Schwestern sind für 28 Leute, dann kann ich mich nicht so intensiv um den kümmern, der relativ viel alleine kann. Ich muss mich dann eben um den kümmern, der Pflegegrad 4 oder 5 hat und auf meine Hilfe angewiesen ist. Ich würde mich natürlich gerne mit der Oma hinsetzen und ein Käffchen trinken und mich mit ihr beschäftigen, unwahrscheinlich gern! Aber in erster Linie muss ich mich eben um die Leute kümmern, die es wirklich brauchen."
Den Angehörigen verständlich zu machen, dass für besondere Zuwendung kaum Zeit ist, sei mitunter schwierig. Besonders angesichts der Kosten eines Pflegeheimplatzes gibt es oft eine gewisse Erwartungshaltung an die Pflegekräfte. Kann diese nicht erfüllt werden, entsteht Missstimmung. Besonders schwer ist es für viele Angehörige, den “Verfall” ihrer Familienmitglieder auszuhalten. Zu sehen, wie die eigene demenzkranke Mutter immer mehr abbaut, macht verständlicherweise traurig, und die Trauer entlädt sich dann manchmal in Wut und Vorwürfen gegenüber den Pflegekräften.
Und obwohl Frau Meier und ihre Kolleginnen solche Situationen der Überforderung kennen und wissen, dass sie den fortschreitenden Krankheitsverlauf nicht aufhalten können und Verständnis für die Gefühle der Angehörigen haben, bleibt es eine Last, die sie auf sich nehmen. Daneben gibt es aber auch viel Dankbarkeit und freundliche Worte. Auch die Pflegekräfte selbst versuchen, stets freundlich zu bleiben, Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, doch es ist “anstrengend, immer lieb zu sein”. Besonders in kritischen Situationen, wie etwa, wenn Bewohner*innen um sich schlagen, beißen, treten. Diesen Teil der Pflege sieht die Gesellschaft nicht, meint Frau Meier. Sie wünscht sich, dass die Perspektive der Pflegekräfte mehr beleuchtet und ihnen mehr Respekt entgegengebracht wird.
Was muss anders werden, und wie kann es gehen?
Dass Frau Meier jeden Tag aufs Neue den manchmal schier unmöglichen Spagat zwischen den Bedürfnissen der einzelnen Bewohner*innen meistern muss, und noch dazu den zwischen Beruf und Familie, liegt nicht an ihrem Arbeitgeber, sondern an dem enormen Fachkräftemangel. Als das Wort bei ihr fällt, kommt das für uns nicht unerwartet. Besonders seit die Pflege durch die Corona-Pandemie wieder zu ein wenig mehr Aufmerksamkeit in den Medien gelangt ist, hört und liest man häufiger über Personalsorgen. Doch was der Fachkräftemangel konkret bedeutet und welche Auswirkungen er auf den Arbeitsalltag einzelner Pfleger*innen hat, wird uns erst im Gespräch mit Frau Meier bewusst. Pflegerin zu sein ist für sie mehr als nur ein Beruf. Für Frau Meier bedeutet es, auch an ihren freien Tagen notfalls ein zu springen, wenn eine Kollegin krank wird. Es bedeutet für sie einen noch höheren organisatorischen Aufwand in ihrem Privatleben, manchmal auch den Verzicht auf Erlebnisse mit ihren Kindern. Aber ihr Beruf ist ihr wichtig, denn sie möchte, dass es den Menschen in ihrer Obhut gut geht. Die Unterbesetzung erfordert eine enorme Einsatzbereitschaft aller Mitarbeitenden; allzu verständlich, dass das auch zu Frustration führt. Denn paradoxerweise fehlt es an Anerkennung dieser Leistung und Arbeit, die für unsere Gesellschaft doch so unverzichtbar und wichtig ist, die uns spätestens seit März diesen Jahres als eine der systemrelevanten Berufsgruppen bekannt ist, die nicht ausfallen darf. Während des Interviews merken wir, wie auch uns diese Situation wütend macht. Doch wie ließe sie sich ändern?
Für Frau Meier ist die wesentliche Maßnahme höhere Gehälter zu zahlen, damit der Beruf lukrativer werde. Ansonsten werde das System Pflege irgendwann zusammenbrechen, weil es einfach keiner mehr machen wolle, vor allem nicht zu diesen Bedingungen. Mindestens genauso wichtig sei, mehr auszubilden und den Personalschlüssel zu erhöhen, um den Druck auf das Pflegepersonal insgesamt zu reduzieren, den Stresspegel zu senken, für Entlastung zu sorgen.
Altenpflege ist ein Beruf mit einem besonders hohen Krankenstand und hoher körperlicher Belastung - diese Ausfälle müssen kompensiert sein. Neben ausgebildeten Pflegekräften wären auch Helfer*innen eine Stütze, die zusätzlich da sind und mit Essen verteilen, waschen und vielleicht mal fünf Minuten für ein Gespräch haben. Frau Meier sieht da auch jene Menschen als Potenzial, die aus der Arbeitslosigkeit in den Beruf wollen und über eine Umschulung in eine solche Hilfstätigkeit der Altenpflege gelangen. Die Berufsausbildung kann ihrer Meinung nach zudem um ein Jahr - auf insgesamt 2 Jahre - verkürzt werden. Neben allen Schwierigkeiten ist es ihr wichtig, auch zu betonen, dass die Altenpflege ein sehr schöner Beruf ist- und mit mehr Personal noch schöner werden könne. Absehbar sind die erforderlichen Veränderungen jedoch nicht.
Die Stimme der Pflegekräfte
Die vermeintliche Alternativlosigkeit der Situation und fehlendes Aufbegehren ihrer Berufsgruppe macht Frau Meier wütend:
“Viele haben sich mit der Situation abgefunden. Eigentlich müssten wir mal auf die Straße gehen und sagen, so geht es nicht weiter! Wir wollen nicht zu zweit oder zu dritt auf dem Wohnbereich stehen! Wir hatten Bewohner, die haben zum Teil zwei Kriege mitgemacht, die wollen vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Zeit haben, und wollen vielleicht nicht nur gewaschen werden und essen! Aber die Zeit hab ich nicht, weil ich schon den nächsten machen muss.”
Ein Problem ist, dass zu wenige Pflegende gewerkschaftlich angebunden und aktiv sind, was zum einen eine Kostenfrage, aber auch eine Frage des Selbstbildes des Pflegepersonals ist: “Die lieben Schwestern” trauen sich nicht zu demonstrieren, aus Angst die Bewohner im Stich zu lassen - vielleicht aber auch aus Angst vor negativer Rückmeldung? Würde sich politisch etwas ändern, wenn Druck aus den Reihen des Pflegepersonals selbst käme? Oder bleibt nur zu hoffen, dass Politik und Gesellschaft die Bedeutung dieser Berufsgruppe erkennen und wertschätzen? Corona verändert vieles, auch die Pflege und deren gesellschaftliche Wahrnehmung, und auch den Alltag von Familien:
„Mein Mann und ich arbeiten beide in systemrelevanten Berufen. Das heißt, als es losging im März mit Corona, hatten wir gleich Anspruch auf Notbetreuung. Ich wäre so froh gewesen, einer von uns wäre in Kurzarbeit gegangen. Einfach aus dieser Angst heraus, wir wussten ja nicht was auf uns zukommt mit dem Virus. Und Sie sind eine von den Eltern, die ihr Kind trotzdem in die Kita bringen muss. Wissen Sie, mit welchem Gefühl ich das gemacht hab?
Ich hätte mich hinstellen können und heulen. Ich dachte, alle anderen können wenigstens mit einem Elternteil zuhause sein, geschützt davor. Und was machen wir? Wir rennen weiter auf Arbeit. Wir mussten die Kinder abgeben. Mich hat das nicht glücklich gemacht und mich macht es auch jetzt nicht glücklich. Wir haben ja beide auch die Gefahr uns zu infizieren auf Arbeit. Ich hatte immer das Gefühl einer Rabenmutter. Und auch jetzt, wir sind ja wieder an der Front, wenn etwas passiert. Wir sind in der Hauptrisikogruppe bei uns im Beruf. Und dann denk ich mir, hätt ich doch lieber irgendwo einen Bürojob … Aber wir brauchen ja wenigstens noch ein paar, die den Beruf mit Herz und Verstand ausüben.“
Pflegerin und Mutter sein - was bedeutet das?
Beim Thema Kinder haken wir noch einmal nach. Wir merken, wie sehr Frau Meier das beschäftigt. Wir fragen sie, was generell getan werden müsste, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, auch in der Lausitz:
„Das Erste, was wichtig wär, sind die Öffnungszeiten der Kitas. Wir haben so viele Leute, die in Schichten arbeiten sind, warum haben wir am Wochenende keine Kinderbetreuung? Was macht man denn, wenn beide Eltern Frühschicht haben? Zwangsläufig heißt das immer, Oma und Opa. Ja, wie war es denn beim Lockdown? Wenn Großeltern absolute Risikogruppe sind, und die Kinder nicht nehmen können?”
Dieses Problem stellt sich auch bei Schließzeiten der Kitas wie im Sommer oder zwischen Weihnachten und Neujahr. Selbst die Abholzeiten nachmittags einzuhalten, ist bei manchen Dienstzeiten schwierig. Was bleibt, ist das schlechte Gewissen; das Gefühl, die Kindheit der eigenen Kinder zu verpassen. Deshalb möchte Frau Meier am liebsten “aus dem Schichtdienst raus”; mehr gemeinsame Zeit mit ihren Kindern verbringen. Momentan ist das innerhalb ihres Trägers allerdings nur umsetzbar, wenn sie in Teilzeit gehen würde. Doch von 20 Stunden kann sie nicht leben, sagt sie. Sie ist dem Träger sehr verbunden und hofft, dass sich in den nächsten Jahren eine Möglichkeit ergeben werde. Ihre Arbeit, das haben wir im Laufe des Gesprächs verstanden, ist für sie nicht nur eine Tätigkeit, für die sie bezahlt wird. Sie ist für sie Teil ihrer Identität, ein Ort, der ihr etwas bedeutet und die Gelegenheit, sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit einer Sache hinzugeben, für die sie brennt. Es macht sie glücklich, zu sehen, wenn die Leute nach einem täglichen “Wasch-Marathon” alle zufrieden und versorgt am Tisch sitzen. Die Menschen in ihrem Heim, sie liegen ihr am Herzen, und sie möchte, dass es ihnen gut geht. Sie selbst und - da ist sie sich sicher - das gesamte Personal ihres Heims, geht an seine Grenzen und darüber hinaus, um für das Wohlergehen der Bewohner*innen bis zum Lebensende zu sorgen.
Abschied mitten im Pflegealltag
Sterben und Tod sind der kritischste und gleichwohl alltägliche Bestandteil dieser Arbeit: Bewohner*innen, die teilweise über Jahre gepflegt und versorgt wurden, zu denen eine Bindung aufgebaut wurde, würdevoll zu verabschieden. Was macht das mit dem Pflegepersonal?
„Am Anfang bin ich regelrecht mitgestorben, ich musste aber mit den Jahren lernen damit umzugehen. Man kann nicht mit allen mit sterben, dann kann man den Beruf nicht machen. Das ist auch der Grund warum ich gesagt hab, ich bin keine Krankenschwester geworden, ich bin Altenpflegerin geworden, weil unsere Leute haben ihr Leben gelebt.“
Wie gehen Frau Meier und ihre Kolleginnen während des hektischen Alltags angemessen mit so einer bedeutsamen und intimen Situation um?
„Wir tun das Beste für die Bewohner … beruhigende Musik, eine Duftlampe, ein schönes Licht, sehr kirchlichen Leuten lesen wir aus der Bibel vor, oder wir legen es den Angehörigen nahe. Wenn wir merken, es dauert nicht mehr lange, sitzt jemand da und hält die Hand. Selbst wenn die schlechteste Personalbesetzung wäre, würden wir immer noch probieren, dass jemand den Kampf nicht alleine durchstehen muss. Ich mach danach immer ein Fenster auf, da kann die Seele in den Himmel gehen. Ich streichel dann auch nochmal über die Hand oder so ...”
Während sie erzählt, wird ihre Stimme leiser und weicher. Sie fühlt, was sie sagt und in dem Moment sind eher wir es, die sich abgrenzen müssen. Und dann? Dann, sagt sie, muss sie auch schon wieder weiter, denn die nächsten warten. Ihre Stimme ist nun wieder bestimmt und entschlossen, aber fröhlich und freundlich. Der “Abschied für immer” passiert innerhalb der routinierten Tagesstruktur, neben alltäglichen Aufgaben, scheinbar belanglosen Tätigkeiten und anderen Herausforderungen. Diese Widersprüchlichkeit von notwendigem Pragmatismus und Bedeutungsschwere des Todes - Frau Meier scheint sie mit Bravour zu meistern.
Unser Gespräch neigt sich dem Ende, denn Frau Meier muss zur Spätschicht. Ihre Kinder hat sie heute Morgen in die Kita gebracht und heute Abend wird sie ihnen über das Telefon Gute Nacht sagen. Sie wird während ihrer Schicht ihr Bestes geben für ihre Bewohner*innen. Nicht, weil sie dafür angemessen bezahlt wird oder dafür Applaus bekommt. Sondern allein aus Überzeugung, dass es das Richtige ist, was sie tut und weil sie ihre Sache gut machen will.
“Wir müssen einfach aus einer schwierigen Situation das Beste machen. Mit einem Lächeln durchs Leben gehen und sagen, wir können es nicht ändern, aber wir müssen das Beste draus machen.”
Susann Anker...
... lebt seit ihrem Studium des M.A. Management Sozialen Wandels mit ihrer Familie in Görlitz und engagiert sich als Ansprechpartnerin bei Mamseel (www.mamseel.de)
Helena John...
... ist Studentin an der Hochschule Zittau/Görlitz und engagiert sich neben dem Studium ehrenamtlich in der Pflege
Das Porträt der Pflegerin entstand im Rahmen der F wie Kraft - ProduzentinnenTour "Pflege in der Lausitz". Alle Informationen über die Tour und alle Stationen sind hier zu finden.
Titelfoto: https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4nde-alte-alter-%C3%A4ltere-menschen-2906458/